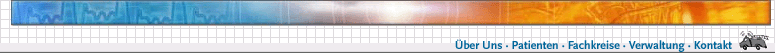
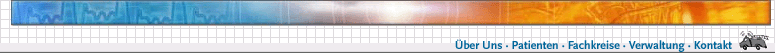 |
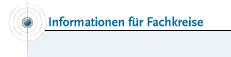 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spastiktherapie
I. Allgemeines zur Spastiktherapie Die intrathekale (rückenmarksnahe) Baclofengabe mittels vollimplantierbarer Medikamentenpumpen ist eine höchste effektive und vergleichsweise risikoarmen Behandlung schwerer spastischer Zustände bei Multipler Sklerose, Schädel-Hirn-Trauma, Querschnittssyndromen und kindlicher Zerebralparese (ZP). Für die Multiple Sklerose und das Querschnittssyndrom besteht die Zulassung des intrathekalen Baclofen seit 1994, die Zulassung zur Spastikbehandlung nach Schädel-Hirntrauma und kindlicher Zerebralparese in Deutschland wurde im Juli 1999 erteilt. Die Spastik beruht auf einer Verminderung der hemmenden Mittlersubstanz (GABA) auf GABAa - Rezeptoren, die in breiter Form im gesamten Zentralnervensystem zu finden sind. Fehlt diese Substanz so kommt es zu einer unwillkürlichen und unkontrollierbaren Anspannung peripherer Muskeln, die je nach Lokalisation und Stärke der Erkrankung den ganzen Körper erfassen kann. Spastik ist dem zu Folge eine Störung der Nervenleitung im Gehirn oder im Rückenmark durch unterschiedlichste Ursachen. Diese Schädigungen können in den meisten Fällen nicht mehr rückgängig gemacht werden, so dass man die Spastik nur indirekt behandeln kann.
II. Auswirkungen auf den Patienten und auf die Gesellschaft Im täglichen Leben ergeben sich oftmals schwere Auswirkungen durch die Spastik.
Hier sind für den Patienten verminderter Schlaf, starke Schmerzen, massive Einschränkung der Beweglichkeit bis hin zur Bettlägerigkeit, schmerzhaften Kontrakturen sowie Darm- und Blasenfunktionsstörungen zu nennen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|